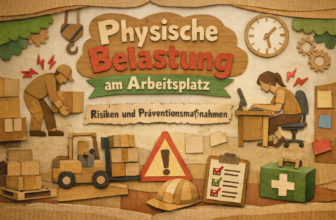Psychische Belastung am Arbeitsplatz betrifft jeden vierten Beschäftigten in Deutschland. Die Ausfallzeiten stiegen in den letzten zehn Jahren um 52 Prozent. Durch systematische Prävention, Gefährdungsbeurteilung und gezielte Maßnahmen können Unternehmen die Gesundheit ihrer Beschäftigten schützen und gleichzeitig Produktivität und Mitarbeiterzufriedenheit steigern.
Einleitung: Die wachsende Bedeutung psychischer Belastung in der modernen Arbeitswelt
In der heutigen Arbeitswelt stehen psychische Belastungen zunehmend im Fokus von Unternehmen und Beschäftigten. Im Jahr 2020 haben sich 25 % der Erwerbstätigen psychischen Belastungen ausgesetzt gefühlt. Diese Entwicklung zeigt: Psychische Belastung ist längst kein Randthema mehr, sondern eine zentrale Herausforderung für die moderne Arbeitswelt.
Die Relevanz für Unternehmen und Beschäftigte ist enorm. DAK-versicherte Beschäftigte hatten insgesamt 323 Arbeitsunfähigkeits-Tage je 100 Versicherte aufgrund psychischer Erkrankungen. Über alle Berufsgruppen hinweg lag das Niveau um 52 Prozent über dem von vor zehn Jahren, was die dramatische Entwicklung verdeutlicht.
Besonders alarmierend: Bis 2025 halten sogar beinahe 70 Prozent (69,3 Prozent) die Gefahr eines Burnouts oder von psychischen Belastungen in ihrer Belegschaft für bedeutungsvoll. Diese Zahlen unterstreichen die Dringlichkeit, mit der sich Unternehmen dem Thema psychische Belastung widmen müssen.
Definition & Grundlagen: Was ist psychische Belastung?

Begriffsbestimmung und zentrale Konzepte
Psychische Belastung wird in der Arbeitswissenschaft als „Gesamtheit aller erfassbaren Einflüsse“ definiert, die von außen auf eine Person einwirken. Belastung ist dabei definiert als Gesamtheit der Einflüsse, die im Arbeitssystem auf den Organismus bzw. die Leistungsfähigkeit des Versicherten einwirken.
Im Sprachgebrauch der Arbeitspsychologie unterscheidet man zwischen:
Belastung: Die objektiven Einflüsse, die von außen auf eine Person einwirken
Beanspruchung: Die individuellen Auswirkungen dieser Belastung auf die Person
Beanspruchungsfolgen: Die langfristigen Folgen, die sich aus der Beanspruchung entwickeln können
Diese Unterscheidung ist fundamental für das Verständnis psychischer Belastungen am Arbeitsplatz. Während Belastung zunächst wertneutral ist, entscheidet die individuelle Beanspruchung darüber, ob sich positive oder negative Auswirkungen entwickeln.
Wichtige Begriffe der Arbeitsgestaltung
Arbeitsorganisation: Die Art und Weise, wie Arbeitsinhalte strukturiert und Arbeitsaufgaben verteilt werden
Arbeitsumgebung: Die physischen und sozialen Bedingungen des Arbeitsplatzes
Belastungsfaktoren: Spezifische Einflüsse, die psychische Beanspruchung verursachen können
Arbeitsanforderungen: Die Gesamtheit der an eine Person gestellten Aufgaben
Ressourcen: Verfügbare Mittel zur Bewältigung der Arbeitsanforderungen
Ursachen psychischer Belastung: Ein multifaktorielles Problem

Arbeitsorganisatorische Faktoren
Die Arbeitsorganisation spielt eine zentrale Rolle bei der Entstehung psychischer Belastung. 14 % der Erwerbstätigen gaben im Jahr 2020 an, durch Zeitdruck und Arbeitsüberlastung am stärksten in ihrem Wohlbefinden beeinträchtigt zu sein.
Zentrale Belastungsfaktoren in der Arbeitsorganisation:
- Zeitdruck und Arbeitsintensität: Zu enge Termine und unrealistische Arbeitsanforderungen
- Unklare Aufgabenverteilung: Fehlende Transparenz bei Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten
- Störungen und Unterbrechungen: Häufige Arbeitsunterbrechungen beeinträchtigen die Konzentration
- Fehlende Planbarkeit: Unvorhersehbare Arbeitsabläufe erschweren die Gestaltung des Alltags
Soziale Beziehungen und Führung
Die Qualität sozialer Beziehungen am Arbeitsplatz beeinflusst maßgeblich das Wohlbefinden der Beschäftigten. Als zweithäufigster Grund wurde mit 5 % Umgang mit schwierigen Kundinnen/Kunden, Patientinnen/Patienten, Schülerinnen/Schülern genannt.
Problematische Faktoren in sozialen Beziehungen:
- Mangelnde Wertschätzung durch Vorgesetzte
- Konflikte im Team
- Fehlende soziale Unterstützung
- Mobbing und Diskriminierung
Arbeitsumgebung und physische Bedingungen
Auch die Arbeitsumgebung trägt erheblich zur psychischen Belastung bei. Lärm, schlechte Beleuchtung oder ergonomische Mängel können das Wohlbefinden erheblich beeinträchtigen und Stress verursachen.
Beispiel für Belastungskombinationen
Ein konkretes Beispiel aus der Praxis: Ein Beschäftigter in einem Callcenter arbeitet unter permanentem Zeitdruck, muss schwierige Kundengespräche führen, hat wenig Gestaltungsspielraum und erhält nur sporadisch Feedback von seinem Vorgesetzten. Diese Kombination verschiedener Belastungsfaktoren erhöht das Risiko für negative Beanspruchungsfolgen erheblich.
Auswirkungen & Folgen: Wie äußert sich psychische Belastung?

Kurzfristige Symptome und Beanspruchungsfolgen
Psychische Belastung äußert sich zunächst in kurzfristigen Beanspruchungsfolgen. Kurzfristig können diese Belastungen zu muskulärer und innerer Anspannung, Nervosität und Kopfschmerzen sowie Konzentrationsschwierigkeiten und Schlafstörungen führen.
Typische kurzfristige Symptome:
- Konzentrationsstörungen und verminderte Aufmerksamkeit
- Nervosität und innere Unruhe
- Schlafstörungen und Erschöpfung
- Kopfschmerzen und muskuläre Verspannungen
- Reizbarkeit und emotionale Labilität
Langfristige Folgen für Gesundheit und Psyche
Bleiben die Belastungen bestehen, können sich schwerwiegende langfristige Folgen entwickeln. Langfristig führen solche Belastungen zum Beispiel zu Burnout, Depressionen, aber auch zu Magengeschwüren und Bluthochdruck.
Burnout als spezifische Beanspruchungsfolge
Das Burnout-Syndrom stellt eine besonders schwerwiegende Form der Beanspruchungsfolgen dar. Als bedeutsamste Symptome des Burnout-Syndroms gelten emotionale Erschöpfung, eine zynische Grundhaltung gegenüber der eigenen Umwelt und eine reduzierte persönliche Leistungsfähigkeit bei der Arbeit.
Die drei Dimensionen von Burnout:
- Emotionale Erschöpfung: Völlige Verausgabung der emotionalen Ressourcen
- Depersonalisation: Zynische Einstellung gegenüber Arbeit und Menschen
- Verminderte Leistungsfähigkeit: Gefühl mangelnder beruflicher Kompetenz
Auswirkungen auf das Arbeitsumfeld
Die Auswirkungen psychischer Belastung beschränken sich nicht auf die betroffene Person. Sie beeinflussen das gesamte Arbeitsumfeld:
- Erhöhte Fehlzeiten und Fluktuation
- Verminderte Produktivität und Qualität
- Verschlechterung des Betriebsklimas
- Höhere Kosten durch Krankheitsvertretungen
Besonders gefährdete Berufsgruppen
Erzieher, Sozialpädagogen und Theologinnen sowie Fachkräfte in der Altenpflege hatten 2023 mit 534 bzw. 531 Tagen je 100 Versicherte die meisten AU-Tage. Diese Berufsgruppen sind besonders gefährdet, da sie intensive emotionale Arbeit leisten und oft unter Personalmangel leiden.
Ursache-Wirkung-Ketten: Vom Einflussfaktor zur Erkrankung

Der Mechanismus von Belastung zu Beanspruchung
Psychische Belastung entsteht durch ein komplexes Zusammenwirken verschiedener Faktoren. Der Prozess läuft typischerweise in folgenden Stufen ab:
- Belastungsexposition: Person wird Belastungsfaktoren ausgesetzt
- Bewertung: Individuelle Einschätzung der Situation und verfügbaren Ressourcen
- Beanspruchung: Physiologische und psychologische Reaktion
- Bewältigung: Versuche, mit der Belastung umzugehen
- Folgen: Je nach Erfolg der Bewältigung positive oder negative Auswirkungen
Beispiel einer Ursache-Wirkung-Kette
Ausgangssituation: Ein Teamleiter erhält zusätzliche Projekte ohne entsprechende Ressourcen.
Ursache-Wirkung-Verlauf:
- Belastung: Erhöhte Arbeitsanforderungen bei gleichen zeitlichen Ressourcen
- Primäre Beanspruchung: Zeitdruck und Stress
- Bewältigungsverhalten: Überstunden, Vernachlässigung von Pausen
- Sekundäre Beanspruchung: Erschöpfung, Schlafmangel
- Langfristige Folgen: Burnout-Symptome, gesundheitliche Probleme
Der Teufelskreis chronischer Belastung
Besonders problematisch wird es, wenn sich ein Teufelskreis entwickelt. Dieser Teufelskreis bekommt durch gravierende Veränderungen in der Arbeitswelt eine zusätzliche Dynamik. Chronische Belastung führt zu verminderter Leistungsfähigkeit, was wiederum zu erhöhtem Druck und weiterer Belastung führt.
Präventionsstrategien & Arbeitsschutz: Systematischer Schutz der Beschäftigten

Gesetzliche Grundlagen und Arbeitsschutzgesetz
Das Arbeitsschutzgesetz bildet die rechtliche Grundlage für Prävention psychischer Belastung. 2013 wurde mit der Nr. 6 auch die Gefährdung durch psychische Belastung aufgenommen. Seitdem sind Arbeitgeber verpflichtet, auch psychische Gefährdungen systematisch zu bewerten.
Die Gefährdungsbeurteilung als zentrales Instrument
Unternehmen sind verpflichtet, in der gesetzlich geforderten Gefährdungsbeurteilung auch auf psychische Belastungsfaktoren einzugehen. Diese umfasst folgende Bereiche:
Sechs zentrale Handlungsfelder:
- Arbeitsinhalte und Arbeitsaufgaben: Vollständigkeit, Variabilität, Handlungsspielräume
- Arbeitsorganisation: Arbeitsintensität, Störungen, Kommunikation
- Arbeitszeit: Dauer, Lage, Planbarkeit, Pausen
- Soziale Beziehungen: Kollegiale und Vorgesetzten-Beziehungen
- Arbeitsumgebung: Physische Bedingungen, Lärm, Raumklima
- Arbeitsmittel: Geeignetheit und Verfügbarkeit der Arbeitsmittel
Rolle der GDA und systematische Herangehensweise
Die Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA) hat umfassende Empfehlungen für die Umsetzung entwickelt. In der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie GDA legen Bund, Länder und Unfallversicherungsträger Handlungsfelder fest, die sie in bundesweiten Arbeitsprogrammen umsetzen.
Beteiligung der Beschäftigten und Interessenvertretung
Dabei ist es sinnvoll, die Beschäftigten als Experten und Expertinnen für ihre eigene Arbeitssituation in das Verfahren einzubeziehen. Die aktive Beteiligung der Beschäftigten und der betrieblichen Interessenvertretung ist entscheidend für den Erfolg präventiver Maßnahmen.
Verhältnisprävention: Gestaltung gesunder Arbeitsbedingungen
Konkrete Maßnahmen der Verhältnisprävention:
- Optimierung der Arbeitsorganisation und -abläufe
- Verbesserung der Arbeitsumgebung
- Schaffung klarer Aufgaben- und Rollenverteilungen
- Förderung partizipativer Führungsstile
- Entwicklung einer gesundheitsförderlichen Unternehmenskultur
Verhaltensprävention: Stärkung individueller Ressourcen
Ergänzend zur Verhältnisprävention stärkt die Verhaltensprävention die individuellen Ressourcen der Beschäftigten:
- Schulungen zu Stressmanagement und Zeitmanagement
- Förderung der Gesundheit durch Bewegung und Entspannung
- Entwicklung von Problemlösungskompetenzen
- Stärkung sozialer Kompetenzen und Kommunikationsfähigkeiten
Konkrete Praxistipps für Arbeitgeber

Sofortmaßnahmen für den Arbeitsschutz
1. Kommunikation und Transparenz schaffen
- Regelmäßige Teamgespräche und Feedback-Runden
- Klare Kommunikation von Zielen und Erwartungen
- Offene Fehlerkultur entwickeln
2. Arbeitsorganisation optimieren
- Realistische Terminplanung und Arbeitsverteilung
- Vermeidung ständiger Unterbrechungen
- Schaffung von Handlungsspielräumen
3. Soziale Unterstützung fördern
- Teambuilding-Maßnahmen
- Mentoring-Programme
- Konfliktmanagement etablieren
Betriebliches Gesundheitsmanagement entwickeln
Ein systematisches betriebliches Gesundheitsmanagement sollte folgende Komponenten umfassen:
- Regelmäßige Gesundheitsbefragungen
- Angebote zur Gesundheitsförderung
- Mitarbeiterberatung und -unterstützung
- Führungskräfte-Entwicklung
Führungskräfte als Schlüsselfaktoren
Führungskräfte spielen eine zentrale Rolle bei der Prävention psychischer Belastung:
- Vorbildfunktion in puncto Gesundheit
- Sensibilität für Belastungssignale bei Beschäftigten
- Unterstützung bei Problemen und Herausforderungen
- Förderung einer wertschätzenden Arbeitskultur
Best-Practice-Beispiele aus der Praxis
Beispiel 1: Flexible Arbeitsmodelle in der IT-Branche
Ein Software-Unternehmen mit 200 Beschäftigten führte flexible Arbeitszeiten und Home-Office-Möglichkeiten ein. Die Maßnahmen umfassten:
- Kernarbeitszeiten von 10:00 bis 14:00 Uhr
- Bis zu drei Home-Office-Tage pro Woche
- Erreichbarkeit nur während der Kernarbeitszeit
Ergebnis: 30% weniger krankheitsbedingte Ausfälle, deutlich höhere Mitarbeiterzufriedenheit
Beispiel 2: Präventionsprogramm im Gesundheitswesen
Ein Krankenhaus entwickelte ein umfassendes Programm gegen psychische Belastung:
- Monatliche Supervision für Pflegekräfte
- Entlastung durch zusätzliches Personal in Spitzenzeiten
- Stressmanagement-Workshops
- Verbesserung der Pausengestaltung
Ergebnis: Signifikante Reduktion der Burnout-Fälle, geringere Fluktuation
Tabelle: Belastungsfaktoren und Präventionsmaßnahmen
Belastungsfaktor | Präventionsmaßnahme | Zuständigkeit |
|---|---|---|
Zeitdruck | Realistische Terminplanung | Führungskraft |
Unklare Aufgaben | Aufgabenbeschreibungen | HR-Abteilung |
Schlechte Arbeitsumgebung | Arbeitssicherheit | |
Fehlende Wertschätzung | Regelmäßiges Feedback | Führungskraft |
Überforderung | Schulungen und Qualifizierung | Personalentwicklung |
Checkliste: Psychische Belastung erkennen
Warnsignale auf organisationaler Ebene:
- [ ] Erhöhte Fehlzeiten in bestimmten Bereichen
- [ ] Häufige Beschwerden über Arbeitsbelastung
- [ ] Hohe Fluktuation
- [ ] Vermehrte Konflikte im Team
- [ ] Rückgang der Arbeitsqualität
Warnsignale bei einzelnen Beschäftigten:
- [ ] Veränderungen im Arbeitsverhalten
- [ ] Sozialer Rückzug
- [ ] Häufige Krankheitstage
- [ ] Reizbarkeit oder Niedergeschlagenheit
- [ ] Konzentrationsprobleme
Die vier zentralen Fragen beantwortet

Wie äußert sich eine psychische Belastung?
Psychische Belastung äußert sich auf verschiedenen Ebenen:
Körperliche Ebene:
- Erschöpfung und Müdigkeit
- Kopfschmerzen und Muskelverspannungen
- Schlafstörungen
- Magen-Darm-Beschwerden
Emotionale Ebene:
- Reizbarkeit und Stimmungsschwankungen
- Ängstlichkeit oder Niedergeschlagenheit
- Gefühl der Überforderung
- Verlust der Arbeitsfreude
Kognitive Ebene:
- Konzentrationsstörungen
- Vergesslichkeit
- Entscheidungsschwierigkeiten
- Grübeln und Gedankenkreisen
Verhaltensebene:
- Sozialer Rückzug
- Erhöhter Substanzkonsum
- Vernachlässigung sozialer Kontakte
- Vermeidungsverhalten
Was löst psychische Belastung aus?
Die Ursachen psychischer Belastung sind vielfältig und wirken oft in Kombination:
Arbeitsinhaltliche Faktoren:
- Monotonie oder Überforderung
- Fehlende Entwicklungsmöglichkeiten
- Widersprüchliche Arbeitsanforderungen
Organisatorische Faktoren:
- Zeitdruck und Arbeitsintensität
- Häufige Unterbrechungen
- Schlechte Arbeitsorganisation
Soziale Faktoren:
- Konflikte mit Kollegen oder Vorgesetzten
- Fehlende soziale Unterstützung
- Mobbing oder Diskriminierung
Umgebungsfaktoren:
- Lärm, schlechte Beleuchtung
- Ungeeignete Arbeitsmittel
- Mangelhafte Ergonomie
Was ist psychische Anstrengung?
Psychische Anstrengung ist die natürliche Reaktion der Psyche auf Arbeitsanforderungen. Sie umfasst:
Definition: Psychische Anstrengung bezeichnet die mentalen Ressourcen, die zur Bewältigung einer Arbeitsaufgabe aufgewendet werden müssen.
Positive Aspekte:
- Fördert Lernen und Entwicklung
- Kann motivierend wirken
- Trainiert mentale Fähigkeiten
Negative Aspekte (bei dauerhafter Überanstrengung):
- Führt zu Ermüdung und Erschöpfung
- Kann in chronischen Stress übergehen
- Reduziert die Leistungsfähigkeit
Der entscheidende Unterschied: Angemessene psychische Anstrengung ist normal und gesund. Problematisch wird es, wenn die Anstrengung dauerhaft die verfügbaren Ressourcen übersteigt.
Was hilft bei psychischen Belastungen?
Ein umfassender Ansatz kombiniert verschiedene Maßnahmen:
Akute Hilfe:
- Professionelle Beratung und Therapie
- Zeitweise Entlastung oder Freistellung
- Medizinische Behandlung bei Bedarf
- Unterstützung durch Familie und Freunde
Langfristige Lösungen auf Arbeitsplatz-Ebene:
- Systematische Gefährdungsbeurteilung
- Verbesserung der Arbeitsorganisation
- Förderung sozialer Unterstützung
- Entwicklung gesundheitsförderlicher Führung
Individuelle Bewältigungsstrategien:
- Erlernen von Entspannungstechniken
- Verbesserung des Zeitmanagements
- Aufbau sozialer Netzwerke
- Entwicklung von Problemlösungskompetenzen
Präventive Maßnahmen:
- Regelmäßige Reflexion der Arbeitsbelastung
- Rechtzeitige Inanspruchnahme von Unterstützung
- Gesunde Lebensführung
- Work-Life-Balance
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Ist psychische Belastung am Arbeitsplatz ein neues Phänomen?
Nein, psychische Belastung gab es schon immer. Neu ist jedoch das wachsende Bewusstsein für das Thema und die systematische Herangehensweise im Arbeitsschutz. Seit 2013 ist die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung gesetzlich verpflichtend.
Müssen alle Unternehmen eine psychische Gefährdungsbeurteilung durchführen?
Ja, alle Arbeitgeber sind unabhängig von der Betriebsgröße dazu verpflichtet – bereits ab dem ersten Mitarbeiter. Die Pflicht ergibt sich aus § 5 Abs. 3 Nr. 6 des Arbeitsschutzgesetzes.
Wie oft muss eine Gefährdungsbeurteilung aktualisiert werden?
Eine Aktualisierung ist erforderlich bei Veränderungen der Arbeitsbedingungen, bei einer Häufung von Beschwerden oder Gesundheitsbeeinträchtigungen sowie bei neuen arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen.
Was ist der Unterschied zwischen Stress und psychischer Belastung?
Psychische Belastung bezeichnet objektive Einflüsse von außen, während Stress die individuelle Reaktion darauf ist. Stress ist also eine mögliche Beanspruchungsfolge von psychischer Belastung.
Können Beschäftigte eine Gefährdungsbeurteilung einfordern?
Ja, Beschäftigte haben das Recht, vom Arbeitgeber die Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung zu verlangen. Der Betriebsrat hat dabei Mitbestimmungsrechte.
Welche Kosten entstehen durch psychische Belastung?
Psychische Erkrankungen verursachen hohe Kosten durch Krankheitsausfälle, verminderte Produktivität und Fluktuation. Prävention ist deutlich kostengünstiger als die Behandlung von Folgeerkrankungen.
Kann ich als Führungskraft eine psychische Gefährdungsbeurteilung selbst durchführen?
Grundsätzlich ja, wenn Sie über ausreichende Fachkenntnisse verfügen. Meist ist jedoch die Unterstützung durch Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Betriebsärzte oder externe Experten sinnvoll.
Was passiert, wenn keine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt wird?
Bei Verstößen gegen die Pflicht zur Gefährdungsbeurteilung drohen Bußgelder. Zudem können bei Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten Regressansprüche der Versicherungen entstehen.
Fazit & Ausblick: Prävention als Schlüssel zum Erfolg
Warum Prävention entscheidend ist
Die Prävention psychischer Belastung ist nicht nur eine ethische Verpflichtung, sondern auch ein wirtschaftlicher Erfolgsfaktor. Beschäftigte, die eine höhere emotionale Bindung zu ihrem Arbeitgeber hatten, waren laut der Befragung auch zufriedener mit ihrer Arbeit, hatten weniger berufliche Fehlzeiten und zeigen eine signifikant geringere Wechselabsicht.
Die wichtigsten Argumente für systematische Prävention:
- Schutz der Gesundheit und des Wohlbefindens der Beschäftigten
- Reduktion von Ausfallzeiten und Krankheitskosten
- Steigerung der Produktivität und Arbeitsqualität
- Verbesserung der Arbeitgeberattraktivität
- Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen
Entwicklungstrends und zukünftige Herausforderungen
Die Arbeitswelt befindet sich im Wandel, was neue Herausforderungen für die psychische Gesundheit mit sich bringt:
Digitalisierung und neue Arbeitsformen:
- Ständige Erreichbarkeit durch digitale Medien
- Entgrenzung von Arbeit und Privatleben
- Neue Formen der Zusammenarbeit im Home-Office
Demografischer Wandel:
- Alternde Belegschaften mit veränderten Bedürfnissen
- Wissenstransfer zwischen Generationen
- Längere Lebensarbeitszeit
Gesellschaftliche Entwicklung:
- Höhere Erwartungen an Work-Life-Balance
- Veränderte Werte der jüngeren Generation
- Zunehmende Sensibilität für psychische Gesundheit
Handlungsempfehlungen für die Zukunft
Für Unternehmen:
- Entwicklung einer präventionsorientierten Unternehmenskultur
- Investition in moderne Arbeitsplätze und flexible Arbeitsmodelle
- Kontinuierliche Weiterbildung von Führungskräften
- Aufbau umfassender Beratungs- und Unterstützungsstrukturen
Für Beschäftigte:
- Aktive Beteiligung an Präventionsmaßnahmen
- Entwicklung persönlicher Bewältigungsstrategien
- Inanspruchnahme verfügbarer Unterstützungsangebote
- Offene Kommunikation über Belastungen und Bedürfnisse
Für die Gesellschaft:
- Weiterentwicklung der gesetzlichen Rahmenbedingungen
- Förderung der Forschung zu psychischer Gesundheit am Arbeitsplatz
- Sensibilisierung der Öffentlichkeit für das Thema
- Stärkung der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren
Schlusswort
Psychische Belastung am Arbeitsplatz ist eine komplexe Herausforderung, die systematische und langfristige Lösungsansätze erfordert. Nur durch die Kombination von Verhältnis- und Verhaltensprävention, die Beteiligung aller Beteiligten und die konsequente Umsetzung erwiesener Maßnahmen können wir eine Arbeitswelt schaffen, die sowohl produktiv als auch gesund ist.
Die Investition in die psychische Gesundheit der Beschäftigten ist eine Investition in die Zukunft des Unternehmens und der Gesellschaft. Unternehmen, die heute handeln, werden morgen nicht nur gesündere und zufriedenere Beschäftigte haben, sondern auch wirtschaftlich erfolgreicher sein.
Quellenverzeichnis
- Statistisches Bundesamt (2023): Gefährdung durch Stress am Arbeitsplatz. Verfügbar unter: https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Qualitaet-Arbeit/Dimension-1/stress-arbeitsplatz.html
- DAK-Gesundheit (2024): Psychreport 2024: Entwicklungen der psychischen Erkrankungen im Job. Verfügbar unter: https://www.dak.de/dak/unternehmen/reporte-forschung/psychreport-2024_57364
- Randstad Deutschland (2024): Wunsch nach Unterstützung für die psychische Gesundheit als Jobkriterium nach Generationen. Statista, verfügbar unter: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1499915/umfrage/wichtigkeit-von-unterstuetzung-fuer-die-psychische-gesundheit-nach-generationen/
- Techniker Krankenkasse (2024): Studie offenbart Ausmaß psychischer Belastungen am Arbeitsplatz. Haufe, verfügbar unter: https://www.haufe.de/personal/hr-management/psychische-gesundheit-am-arbeitsplatz/psychische-erkrankungen-von-beschaeftigten-steigen-enorm_80_590678.html
- AOK (2024): Fehlzeiten-Report 2024: Weniger Krankschreibungen bei Beschäftigten mit höherer emotionaler Bindung. Verfügbar unter: https://www.aok.de/pp/bv/pm/fehlzeiten-report-2024/
- Haufe (2024): Pflicht zur psychischen Gefährdungsbeurteilung. Verfügbar unter: https://www.haufe.de/personal/hr-management/psychische-gesundheit-am-arbeitsplatz/pflicht-zur-psychischen-gefaehrdungsbeurteilung_80_585044.html
- BGW – Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege: Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung. Verfügbar unter: https://www.bgw-online.de/bgw-online-de/themen/sicher-mit-system/gefaehrdungsbeurteilung/gefaehrdungsbeurteilung-psychischer-belastung-23100
- BG RCI (2024): Die psychische Belastung in der Gefährdungsbeurteilung. Verfügbar unter: https://www.bgrci.de/psybel
- DGUV – Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung: Prävention – Burnout-Syndrom. Verfügbar unter: https://www.dguv.de/de/praevention/themen-a-z/psychisch/burnout-syndrom/index.jsp
- Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin: Studie Mentale Gesundheit bei der Arbeit (S‐MGA). Verfügbar unter: https://www.baua.de/DE/Themen/Monitoring-Evaluation/Zahlen-Daten-Fakten/S-MGA
- EY (2023): Entwicklung der Arbeitsbelastung in Deutschland. Statista, verfügbar unter: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1396294/umfrage/entwicklung-der-arbeitsbelastung-in-deutschland/
- Pronova BKK (2024): Studie: Arbeiten zwischen Burn-out und Bore-out. Verfügbar unter: https://www.pronovabkk.de/unternehmen/presse/pressemitteilungen/pressemitteilungen-2024/deutschlands-arbeitnehmer-innen-zwischen-burn-out-und-bore-out.html
Alle Quellen wurden im Zeitraum Januar 2024 bis Januar 2025 abgerufen und entsprechen dem aktuellen Stand der Wissenschaft und Gesetzgebung.